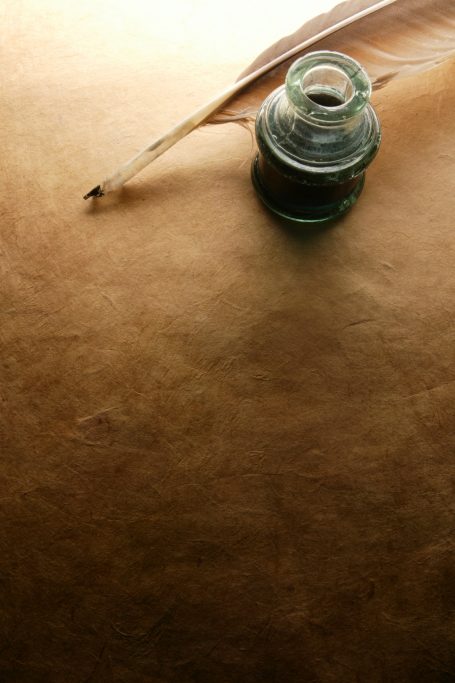"Wie kommt man denn auf so eine Idee?"

Diese Frage stellte mir vor vielen Jahren ein Bekannter, als ich ihm von meinem Romanprojekt erzählte. Was ich ihm damals geantwortet habe, weiß ich heute gar nicht mehr. Seitdem ist in meinem Leben viel passiert. Anfang 2020 habe ich den Roman zum ersten Mal in Eigenregie veröffentlicht. Dann kam die Pandemie und mit ihr - wie wohl für nicht wenige - eine Lebenskrise, die mich bewegte, vieles zu hinterfragen - auch meinen konservativ-christlichen Glauben, der mir bis dahin viel bedeutet hatte.
Im Jahr 2024 stand ich vor der Frage, was ich mit meinem Roman anfangen sollte. So, wie er damals war, konnte ich ihn nicht mehr vertreten. Zwei Optionen standen zur Wahl: Ich nehme ihn vom Markt - wo ihn zu meiner Erleichterung so gut wie niemand gefunden hatte - und lasse ihn von der Bildfläche verschwinden. Oder ich erzähle die Geschichte neu auf eine Art, die ich aus meiner heutigen Weltsicht heraus vertreten kann. Wie du siehst/ Sie sehen, habe ich mich für die zweite Option entschieden, denn ich hatte sehr viel in diese Geschichte investiert. Diese Arbeit verdiente Respekt, und zwar in erster Linie meinen eigenen.
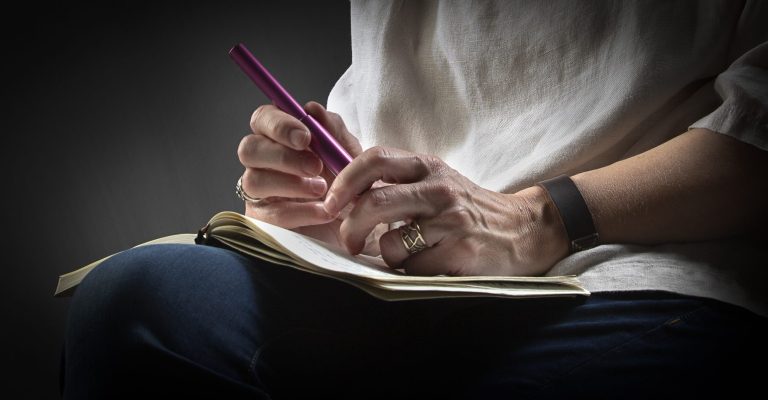
Der Apostel Paulus und ich

In meiner akademischen Abschlussarbeit durfte ich gegen Ende der 1990er Jahre vier zeitgenössische "Artusromane" unter einer feministischen Fragestellung vergleichend analysieren. Schon im Grundstudium hatte ich mir fest vorgenommen, eines Tages selbst einen Roman über den legendären König zu verfassen - und natürlich über seine Ritter und die Frauen an seinem Hof. Wie kam es nun dazu, dass ich der Artuslegende und dem Mittelalter mit Anfang dreißig den Rücken kehrte und mich in meinem ersten historischen Roman stattdessen dem Römischen Kaiserreich zuwandte?
Nebenbei bemerkt: Das Mittelalter, insbesondere die Zeit um 900 n.u.Z., fasziniert mich nach wie vor und inzwischen ist auch eine Idee für ein entsprechendes Projekt entstanden: eine historisch-fantastische Nacherzählung verschiedener Märchen und Mythen, die ich wohl unter einem anderen Pseudonym veröffentlichen werde. Als Nic D. Lennart habe ich mich der Enstehung und Entwicklung der frühen christlichen Kirche in Europa verschrieben. Auch nach meiner Abwendung vom konservativen Glauben kurz nach dem Erscheinen der ersten Auflage meines Korinth-Romans im Jahr 2020 sehe ich in dieser Thematik einen reichen Schatz an Erzählstoff. Doch was, um zur Ausgangsfrage zurückzukehren, bewegte mich nun ursprünglich, einen Roman über die Gründung einer der ersten christlichen Gemeinden in Europa zu schreiben? Und worin unterscheidet sich die erste Auflage von der zweiten?
Der erste Ideenfunke sprang bei meiner Beschäftigung mit verschiedenen Paulus-Briefen im Zweiten Testament. Nachdem der christliche Glaube und die bibeltreue Gemeinde, der ich mich angeschlossen hatte, zu sehr wichtigen Bestandteilen meines Lebens geworden waren, erkannte ich, dass ich nicht darum herumkommen würde, mich mit diesen Texten auseinanderzusetzen. Sympathisch wurde Paulus als Mensch mir dadurch allerdings nicht: Allzu streng erschienen mir einige seiner Forderungen an die Gemeinden in seinen Briefen; nahezu unerfüllbar seine Ansprüche an "ernsthafte" Gläubige. Einen Paulus-Roman wollte ich schreiben, um den Mann und sein Anliegen besser zu begreifen, und machte mich ans Werk. Bald jedoch ließ mein Interesse an der Person des Apostels nach. Im selben Maß wuchs das an den Menschen, an die er - angeblich höchspersönlich - seine berühmten Briefe adressiert hatte: Wer waren diese Leute? Was machte sie und ihr Leben aus? Wie kamen sie dazu, den christlichen Glauben anzunehmen und welche Folgen hatte dieser Schritt für ihr Leben und ihre Beziehungen?
So kam es, dass die Charaktere, deren Namen noch heute vielen aus dem Zweiten Testament bekannt sind, in meiner Geschichte zu Nebenfiguren geworden sind. Stattdessen rückten zwei fiktive Familien in den Vordergrund; die der Töpferin Kynthia und ihres Bruders Phaistos auf der einen Seite und die Familie von Danaë, der jungen Verlobten von Phaistos und Tochter eines Pferdezüchters, auf der anderen. Diese drei Figuren, aus deren Perspektiven im Wechsel die Geschichte erzählt ist, schließen sich der Gemeinschaft um Paulus an – der in meinem Roman PAULOS heißt, denn erstens nennt man ihn in Griechenland so und zweitens ist „mein“ Apostel im selben Maß ein Produkt meiner Fantasie ist wie die unzähligen künstlerischen Darstellungen dieser berühmten biblischen Figur aus früheren Epochen der Vorstellung anderer Kunstschaffender entsprangen.
Unter den Gemeinden, die vom Apostel Paulus gegründet wurden, fiel deshalb meine Wahl auf Korinth, weil die biblische Apostelgeschichte berichtet, dass Paulus dort mit seiner Guten Nachricht auf besonders heftigen Widerstand stieß. Dieser Konfliktreichtum wäre mir bei meinem ursprünglichen Vorhaben, einen „Paulus-Roman“ zu schreiben entgegengekommen. Die Familiengeschichte, die letztlich daraus geworden ist, könnte wohl an jedem der in der Apostelgeschichte genannten Orte spielen, denn Paulus nimmt in der jetzt vorliegenden Fassung nur noch insoweit eine Rolle ein, wie er und seine Botschaft auf das Leben und Denken meiner fiktiven Charaktere Einfluss nehmen.
Ist die zweite Auflage Paulus-kritischer als die erste? Diese Frage dürfte sich aufdrängen und ich kann sie mit einem klaren NEIN beantworten. Ich habe den Roman nicht überarbeitet, um meiner nun kirchen- und bibelkritischen Haltung Ausdruck zu verleihen, sondern um die Geschichte zu öffnen: Selbstverständlich spielt der christliche Glaube nach wie vor eine Rolle. Und ich wage zu behaupten, dass meine intensive Beschäftigung mit der Bibel über fünfzehn Jahre hinweg – sowohl privat als auch bei der professionellen Übersetzung von populärwissenschaftlichen Kommentaren zu einer Reihe von biblischen Büchern aus dem amerikanischen Englisch – der zweiten Auflage meines Romans im selben Maß zugute gekommen ist wie der ersten. Der Unterschied zwischen den beiden Auflagen liegt darin, dass mein persönlicher Glaube bei der Überarbeitung keine Rolle spielte, während die erste zweifelsohne spürbar von meiner eigenen tiefen Frömmigkeit geprägt war. Zumindest war diese Bereinigung mein Vorsatz bei der Überarbeitung des Romans. Ein evangelischer Pfarrer a. D. stand mir freundlicherweise mit seiner Bereitschaft, den kompletten Text vor dem letzten Schliff aus Sicht eines seit jeher liberal gesinnten Christen zu lesen, zur Seite.
So ist KÓRINTHOS nun hoffentlich genau die Art von Erzählung geworden, der seit meinem Grundstudium an der Ruhr-Universität Bochum meine Leidenschaft galt: ein historischer Roman, nicht mehr und nicht weniger – und damit eine Geschichte, die meinen Leserinnen und Lesern eine andere, vielleicht sogar neue Perspektive auf das Leben eröffnet, und die sie gleichzeitig berührt, weil das, was meine Figuren erleben und erleiden längst nicht so weit von ihrer eigenen Erfahrung entfernt ist, wie der zeitliche Abstand von beinahe 2000 Jahren vermuten lässt.